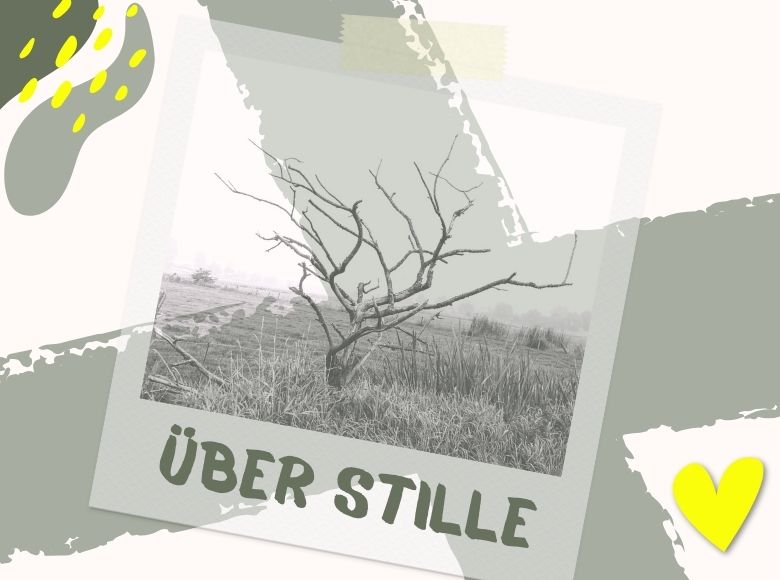Wenn Stille zum Feind wird.
Was macht Stille mit Dir, wenn Du viele Jahre bemüht warst, in der lauten Welt Deinen Weg zu finden?
Die „laute Welt“ oder die „geräusch-lastige Welt“- das kann man wortwörtlich nehmen und auch als Bild für das, was in Dir dauerhaft Lärm verursacht. Laut ist in unserer Welt, wie wir sie erleben, so vieles. Wie intensiv oder störend Du die Lautstärke wahrnimmst, ist individuell. Und es ist Gewöhnung. Laut wird irgendwann zum Hintergrundrauschen.
Wir Menschen haben ein ganz unterschiedliches Verständnis davon was wir als laut empfinden, bzw. wann laut gleichzeitig als Lärm bezeichnet wird.
Lautstärke ist messbar. Es gibt Grenzwerte für Lebensräume oder Arbeitsplätze. Es gibt Schutzausrüstung für Menschen, die gezwungenermaßen einer unvermeidbaren Lärmbelästigung ausgesetzt sind. Es gibt persönliche Schutzmaßnahmen, um sich sein eigenes Gehör nicht dauerhaft zu schrotten oder durch Störgeräusche aus dem Schlaf gerissen zu werden.
Lautstärke belastet, Geräusche können uns irre werden lassen. Beides kann krank machen. Technisch messbar und ggf als grenzwertig einzustufen ist die Lautstärke, nicht aber Geräusche, bzw. deren Nervpegel. Also natürlich sind die auch messbar. Aber Geräusche nerven nicht per se durch eine hohe dB-Zahl. Sie nerven anders, nicht zuletzt durch unerbittliche Kontinuität und zuverlässiges in Erscheinung treten.
Ich bin ein Dorfkind. Aufgewachsen bin ich am Elbdeich im schönen Schleswig-Holstein. Ruhig war’s. Nix los – quasi. Selten gab es so richtig laute Sachen. Vielleicht die samstäglichen Rasenmäher im Sommer. Man hörte die Dieselmotoren der Schiffe, die auf dem Weg in die Nordsee oder zum Nord-Ostseekanal waren – oder daher kamen. Man hörte ab und zu die Schafe blöken oder die Nachbarn schnattern. Nichts davon war wirklich laut. Vielmehr war es durch die sonstige Ruhe erst wahrnehmbar.
Wie entspannend diese Ruhe war, habe ich früher nicht wahrgenommen. Als Kind konnten wir überall spielen und die Zeit überwiegend draußen verbringen. Mit Beginn der Sturm-und-Drang-Phase wurde diese Ruhe eher doof, weil ja nichts los war. So haben wir die Nähe zur nächstgrößeren Stadt gesucht. Feiern, laut sein, tanzen, singen, trinken – was so dazu gehörte.
Wie schön aber, dass wir am nächsten Morgen immer entspannt in der Ruhe des Landlebens ausschlafen konnten!
Nach dem Abi zog es mich, genau wie viele andere, dann aber in die Stadt. Raus aus dem „hier passiert ja nix“, rein ins Getümmel.
Und da war sie dann, die Lautstärke.
Wohnen und lernen an einer Hauptstraße. Das Fenster bitte nicht öffnen, damit man seine Ruhe hat. Getröte, Geschrei, Verkehrslärm. Es ist nie wirklich still. Anstrengend. Zum Glück hatte ich noch ein Fenster zum Hinterhof. Da ging’s.
Aber ich gewöhnte mich dran. Und der Lärm wurde zum Hintergrundrauschen. Das ging vergleichsweise schnell. Und dann wechselte auf einmal die Wahrnehmung.
Denn dort, auf dem Land, wo es sonst so angenehm ruhig war wurde es plötzlich still. Ungewohnt. Zu der Zeit nicht weiter schlimm.
Ich habe mir keine Gedanken über laut und leise, still oder nervig gemacht. Es war einfach immer wie’s war.
Das Einfinden in den ersten Job, immer mal wieder ein Wohnungswechsel usw. alles ok. Da gab es dann andere Dinge, die scheiße waren.
Aber schleichend, auch aus dem Umstand heraus zu wenig achtsam mit mir gewesen zu sein, begann hier eine Spirale, die mein „inneres Sein“ mit Lautstärke füllte.
Während mich Lärm nicht weiter kratzte, war es in meinem Leben nicht mehr ruhig, nicht mehr still. Was mir damals fehlte weiß ich heute. Aber das war ein langer Weg, ein Weg der schmerzhaft war – für mich und mitunter auch für andere.
In dieser Tretmühle gefangen, eine Tretmühle des emotionalen Überleben-Wollens gibt es kein „leise“ mehr. Es gibt nur die Versuche, den inneren Lärm zu überpflastern.
Arbeit. Arbeit ist ein praktisches „Pflaster“. Es lenkt ab, man wird dafür bezahlt, man schafft was, man ist unter Leuten, hat sogar ein bisschen Spaß, man kann so lange arbeiten wie es einem gefällt, keiner schickt Dich nach Hause. Man muss nur die Nacht zu Hause verbringen, irgendwie überstehen. Und dann kann man direkt morgens wieder unter das Pflaster kriechen. Und das kann man sehr, sehr lange so treiben.
Keinen Gedanken muss man verschwenden, wie man sein Leben leben möchte, ob man irgendwann eine Beziehung, Familie und diesen ganzen Kram haben möchte. Unter dem Pflaster braucht man sich keine weiteren Gedanken um die Zukunft machen. Ich habe nicht mehr gespürt, was mir fehlt.
Und das ist – oder war für mich – in dem Moment so gut. Denn alles andere hätte mich in die pure Verzweiflung getrieben. Ich hätte festgestellt, dass da nichts ist. Keine Hoffnung, keine Vision, kein Mut.
Wir alle kennen das Problem mit dem Pflaster. Das hält nicht ewig. Es beginnt vom Rand her abzuflättern. Nach und nach löst es sich und gibt die Wunde frei.
Ich weiß nicht, ob für mich dieses langsame Abkrümeln des Pflasters besser oder schlechter war, als ein radikales Abreißen gewesen wäre. Aber diese Überlegung würde im Nachhinein zu nichts führen.
Ich habe das Pflaster nicht selbst abgezogen – vielleicht das letzte Stück. Das Stückchen des Pflasters, das so halbverwachsen mit der langsam heilenden Wunde zusammenklebt.
Es war ein Kampf meiner Glaubenssätze gegen meine Werte, der täglich von Menschen angestachelt wurde. Die Kampfarena war mein Kopf. Dieser Kampf hat in mir einen so unfassbaren Lärm veranstaltet. So sehr, dass ich ihn eigentlich nicht hätte aushalten können. Eigentlich, denn ich habe ihn ausgehalten.
Viel zu lange habe ich versucht, dieses Pflaster weiterhin zu nutzen, obwohl es schon lange nicht mehr brauchbar war.
Und dann kam Corona.
Vielleicht braucht es mitunter eine höhere Macht, die einen mal so richtig durchschüttelt. Und vielleicht muss die auch radikal sein, um gegen radikale innere Kämpfe eine Chance zu haben.
(Nein, keiner der Menschen, die darunter gelitten haben und noch immer leiden brauchten das wirklich! Im Gegenteil, keiner hat das wirklich gebraucht. Ich auch nicht. Keine Krankheit, keine Naturkatastrophe sollte benötigt werden, um selbst irgendwann mal klarzukommen. Nun war sie aber da, die Epidemie, und hat in irgendeiner Weise überall Spuren hinterlassen.)
Homeoffice und Quarantäne – kein Schutz der Ablenkung durch andere Menschen. Kein Fliehen vor dem Privatleben. Und vor allem keine Flucht mehr vor den Gedanken und Gefühlen, die man nicht eingeladen hat, die sich aber immer wieder sturmklingelnd vor die Haustür stellen wie ein lästiger Klinkenputzer.
Ich hatte mich irgendwie arrangiert. Projekte, Aufgaben – je mehr desto besser.
Was in mir unbewusst und weiterhin zugepflastert noch immer lief? Ein Kampf. Werte gegen Glaubenssatz.
Wie kann ich z.B. für Wertschätzung eintreten (wollen) und es gleichzeitig zulassen, dass dieser Wert, der für mich unerlässlich im Miteinander ist, mit Füßen getreten wird. Ja, letztlich auch von mir. Aus reiner Angst.
Revolte, Aufstand – das gehört sich nicht. „Dann verlierst Du alles!“ „Dann geht Deine Welt unter.“
Kurz, man kann so nicht leben, ohne dabei nicht selbst vor die Hunde zu gehen. Dieser Kampf ist bitter, nachhaltig schambehaftet und frisst Dich von innen auf. Er macht Dich schwach und lässt Dich zu jemandem werden, der sich irgendwann selbst nicht mehr ertragen kann.
Es kommt der Punkt, an dem Du diesen Kampf in gewisser Weise verlierst. Und das ist Glück im Unglück. Nein, eigentlich ist das ein Gewinn.
Es ist kein „Erwachen“ im Sinne einer höheren Eingebung. Du siehst kein helles Licht auf Dich zuschweben, dass Dich erleuchten möchte. Es wird erstmal nur eines – ziemlich dunkel.
Diesen Punkt habe ich erreicht, als es still wurde (ganz physikalisch „leise“ durch den Umzug auf’s Land), als das gemütliche Pflaster nicht mehr schützend auf mir lag, als ich es zugelassen habe, dass das Leben mehr zu bieten hatte als „willkommene Ablenkung“, als da plötzlich Zuwendung, Liebe und Vertrautheit war, als ich einfach so sein durfte wie ich bin, als ich mich nicht mehr anstrengen musste um geschätzt zu werden.
Und plötzlich wird es still.
Eine Stille, die ich innerlich schwer aushalten konnte.
Ich muss was tun, ich kann nicht nichts tun. Das gehört sich auch nicht. Wenn ich nichts tue, bin ich nicht wertvoll. Wenn ich so in den Tag lebe, dann schaffe ich nichts. Das darf man nicht. Man muss was leisten, um anerkannt zu werden.
Und dann fängst Du an irgendwas zu tun. Hauptsache Ablenkung. Egal welche. Heute dies, morgen das.
Es ist ein sehr langer Weg, Stille zu akzeptieren.
Zu wissen, dass man für die Menschen, die einen lieben und schätzen nicht an Wert verliert, wenn man anfängt, sich einfach mal gesund um sich selbst zu kümmern ist so dermaßen heilsam, dass ich es kaum in Worte fassen kann.
Hier geht es nicht um den Verstand, der Dir das sagt. Es geht darum, es zu fühlen, selbst überzeugt davon zu sein.
Stille ist hart. Stille lässt Dich hören. Stille ist ein Freund, der sich vielleicht zunächst als Feind darstellt und erkannt werden möchte. Stille muss man aushalten. Stille muss man schätzen lernen. Stille braucht Mut. Und Stille ist heilsam.
Ich wünsche euch allen im richtigen Moment ein wenig Stille.
Und ich hoffe, wenn die Stille an eure Tür klopft, hört ihr euch zumindest an, was sie euch zu sagen hat.